
|
Graeme J.N. Gooday: The Morals of Measurement. Accuracy, Irony, and Trust in Late Victorian Electrical Practice, Cambridge: Cambridge University Press 2004, XXV + 285 S., ISBN 0-521-43098-4, GBP 55,00 Rezensiert von:
Graeme Gooday, Senior Lecturer in History and Philosophy of Science an der University of Leeds, UK, hat eine Geschichte der Elektrotechnik im viktorianischen England geschrieben, in deren Mittelpunkt das Messen und Quantifizieren elektrischer Energie steht. Ausgangspunkt der Studie ist die enorme Bedeutung, die quantifizierbares Wissen in den Technikwissenschaften des ausgehenden 19. Jahrhunderts erlangte. Elektrizität, so das Credo der aufstrebenden Elektrotechniker, müsse genau messbar sein, um besser verstanden und sicher angewandt werden zu können. Quantifizierung, Standardisierung und Visualisierung waren somit Teil eines elektrotechnischen Fortschrittsideals, das im elektrischen Strom eine saubere, kontrollierbare und universell einsetzbare Kraft erblickte: Um 1900 galt Strom als die Energieform des neu angebrochenen Jahrhunderts. Vor diesem Hintergrund zeichnet Gooday die Entwicklungsgeschichte elektromagnetischer und elektromechanischer Messgeräte wie Amperemeter, Elektrodynamometer, Galvanometer oder Voltmeter nach, skizziert die Schwierigkeiten, mit denen Labortechniker und Prüfingenieure bei der Entwicklung und Herstellung zu kämpfen hatten und fragt danach, wie "Messen" und "Anzeigen" in technischen Genauigkeitsdiskursen immer neu verhandelt werden mussten (Kapitel 2 und 3). Gooday erzählt in "The Morals of Measurement" jedoch nicht einfach eine Geschichte von elektrotechnischen Fortschrittsnarrativen, die sich in neuen Instrumenten materialisierten. Ihm geht es um die Einführung einer anthropologischen Kategorie, die für das Verständnis der komplexen Herstellungs- und Vermittlungsprozesse von technischen Messgeräten unverzichtbar sei: um Vertrauen (trust). Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, so Goodays These, sei die Herstellung und Durchsetzung neuer technischer Messgeräte mit dem Aufbau komplexer Vertrauensbeziehungen einhergegangen. Nur dort, wo sich Vertrauen in die Genauigkeit der Geräte gebildet habe, seien diese auch erfolgreich gewesen, sprich zur Massenproduktion gelangt. Weder in Labors noch in Fabriken und Haushalten war Vertrauen in das, was die neu erfundenen Messgeräte zeigten, eine Selbstverständlichkeit. Gooday beschreibt eine Welt der sozialen Aushandlungsprozesse zwischen sicherem und unsicherem Wissen, neuen Wahrheiten und alten Gewohnheiten: Laborwissenschaftler blieben ihren eigenen Erfindungen gegenüber skeptisch und lehnten jegliche numerisch-optische Repräsentation ab; praktisch arbeitende Ingenieure griffen bei der Installierung und Überwachung von elektrisch betriebenen Maschinen auf ihr Empfindungs- und Erfahrungswissen zurück. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es vor, dass Elektroingenieure ihrem Körper mehr vertrauten als technischen Messgeräten und absichtlich in den Stromkreis griffen, um sich vom Fließen des Stroms zu vergewissern. Demgegenüber stand die Einführung der neuen Messgeräte, die sich sowohl mit den Interessen der Elektrizitätswirtschaft wie auch mit dem Wissenschaftsideal der "mechanischen Objektivität" [1] kompatibel zeigten: Das direkte Lesen technischer Parameter wie Stromstärke oder Spannung auf Anzeigetafeln war schneller, genauer und einheitlicher als bislang und drängte jede Form subjektiver Deutung oder Manipulation in den Hintergrund. Wie konnten die Messergebnisse so präsentiert werden, dass sie auch "richtig" gelesen wurden? Wie funktionierten die "reading technologies" in der Praxis? Eindrücklich beschreibt Gooday im letzten Teil der Studie, wie Verbraucher auf neue Messgeräte reagierten. Aus der Sicht der Elektrotechnik mochte ein neues Messgerät "besser" arbeiten als das Alte. Wenn es jedoch nicht die Seh- und Lesegewohnheiten der praktisch arbeitenden Ingenieure und der Verbraucher bediente, stand die Einführung des neuen Geräts auf wackeligen Beinen. Um beim Beispiel des Stromzählers zu bleiben: Die Einführung dieses Messgeräts stieß um 1890 auf erhebliche Schwierigkeiten. Haushalte, die elektrisches Licht hatten, waren zuvor gewohnt, an ihren Stromversorger eine jährliche Pauschale zu zahlen, deren Höhe von der Zahl der benutzten Glühbirnen abhängig war. Der Abrechnungsmodus berücksichtigte somit nur die Anzahl der Lampen, nicht aber deren tatsächliche Brenndauer. Manche Unternehmen gingen daran, an jeder Lampe eine Uhr zu montieren, welche die Brenndauer der Glühbirne registrierte, doch erwies sich das als zu zeit- und kostenintensiv. Das Strommessgerät versprach eine ebenso genaue wie einfache Handhabung des Problems. Die für den Verbraucher jederzeit ersichtliche, numerische Anzeige des Stromverbrauchs, das "Zählen" des Stroms, war jedoch ursprünglich nicht vorgesehen. Das Strommessgerät der ersten Generation, von Edison entworfen, bestand aus elektrolytischen Zellen, die monatlich entfernt und im Labor des Energieversorgers ausgewertet werden mussten. Diese Vorgangsweise stieß auf den Widerstand der Verbraucher, die sich aus dem Überwachungsprozess ausgeschlossen fühlten. Das Strommessgerät musste hinsichtlich Design und Funktionsweise erst dem vertrauten Gas- und Wasserzähler angeglichen werden, um akzeptiert zu werden. Das Beispiel des Strommessgeräts führt zur Kernaussage in Goodays Buch zurück: Ob ein neu konstruiertes technisches Messgerät angenommen wird oder nicht, ist nicht nur eine Frage von "harten" Faktoren wie Macht, Autorität und Durchsetzungsvermögen, sondern hat viel mit subjektiven und emotionalen Kategorien, sprich mit dem Aufbau tragfähiger Vertrauensbeziehungen (networks of trust) zu tun. Auf knapp dreihundert Seiten expliziert und variiert Gooday diese These mit enormer Literaturkenntnis und reichhaltigen empirischen Arrangements. Am Ende zögert man jedoch etwas, Vertrauen (trust) als die zentrale Analysekategorie dieses Buches zu akzeptieren. Dies liegt an der diffusen Verwendung des Vertrauensbegriffs, der anfangs nicht präzise genug definiert und mit Fortdauer des Buches mit Begriffen wie accuracy, behaviour, competition, honour, interest oder power vermengt wird. Sicher, erst die Zusammenschau dieser Kategorien ermöglicht ein besseres Verständnis jener morals of measurements, um die es Gooday letztendlich geht. Doch hätte sich eine eingehendere Auseinandersetzung mit sozialwissenschaftlichen und soziologischen Arbeiten zum Vertrauensbegriff gelohnt [2], um dem eigenen Vorgehen mehr Definitionsschärfe und Überzeugungskraft zu verleihen. Von diesem Kritikpunkt abgesehen, ist Graeme Gooday mit "The morals of measurement" eine überaus anregende Studie gelungen, die thematisch an die Arbeiten von Steven Shapin und Theodore Porter anschließt. [3] Mit einer profunden Darstellung der Materie und provokanten Exkursen zu neueren wissenschaftshistoriografischen Debatten richtet sich das Buch vor allem an Technik- und Wissenschaftshistoriker, die sich zu einem neuen Blick auf die Geschichte der Elektrotechnik herausgefordert sehen werden. Anmerkungen: [1] Lorraine Daston / Peter Galison: The Image of Objectivity, in: Representations 40 (1992), 81-128. Deutsche Übersetzung in Peter Geimer (Hg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, Kunst und Technologie. Frankfurt am Main 2002, 29-99. [2] An englischsprachigen Arbeiten seien hier genannt: Piotr Sztompka: Trust. A sociological theory. Cambridge 1999; Shmuel N. Eisenstadt: Power, trust, and meaning. Essays in sociological theory and analysis. Chicago 1995. Aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive zuletzt Ute Frevert (Hg.): Vertrauen. Historische Annäherungen. Göttingen 2003. [3] Theodore Porter: Trust in numbers. The pursuit of objectivity in science and public life. Princeton 1995; Steven Shapin: A social history of truth: Civility and science in seventeenth century England. Chicago 1994. Redaktionelle Betreuung: Martina Heßler Empfohlene Zitierweise: |
|||||||||||||||||||||||||||||

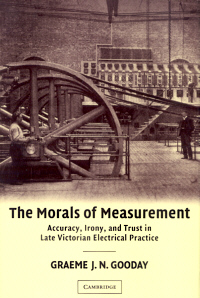 Strom abzulesen ist einfach: Als Verbraucher können wir unseren Stromkonsum anhand des Stromzählers feststellen - ein Blick auf eine Zahlenreihe und deren Vergleich mit einer früher notierten genügen. Ein Stromzähler ermöglicht auch Energieversorgern eine exakte und unkomplizierte Abrechnung. Aber was genau zeigt dieser Zähler? Lässt sich Strom überhaupt "zählen"? Stimmt der numerisch aufgezeichnete Stromverbrauch mit dem tatsächlich verbrauchten Energiequantum überein? Wir vertrauen darauf, dass der Stromzähler jedes Mal, wenn wir den Lichtschalter oder ein elektrisches Gerät betätigen, eine präzise Aufzeichnungsarbeit leistet; das Gerät misst das, was messbar ist und es zeigt an, was anzuzeigen ist.
Strom abzulesen ist einfach: Als Verbraucher können wir unseren Stromkonsum anhand des Stromzählers feststellen - ein Blick auf eine Zahlenreihe und deren Vergleich mit einer früher notierten genügen. Ein Stromzähler ermöglicht auch Energieversorgern eine exakte und unkomplizierte Abrechnung. Aber was genau zeigt dieser Zähler? Lässt sich Strom überhaupt "zählen"? Stimmt der numerisch aufgezeichnete Stromverbrauch mit dem tatsächlich verbrauchten Energiequantum überein? Wir vertrauen darauf, dass der Stromzähler jedes Mal, wenn wir den Lichtschalter oder ein elektrisches Gerät betätigen, eine präzise Aufzeichnungsarbeit leistet; das Gerät misst das, was messbar ist und es zeigt an, was anzuzeigen ist.